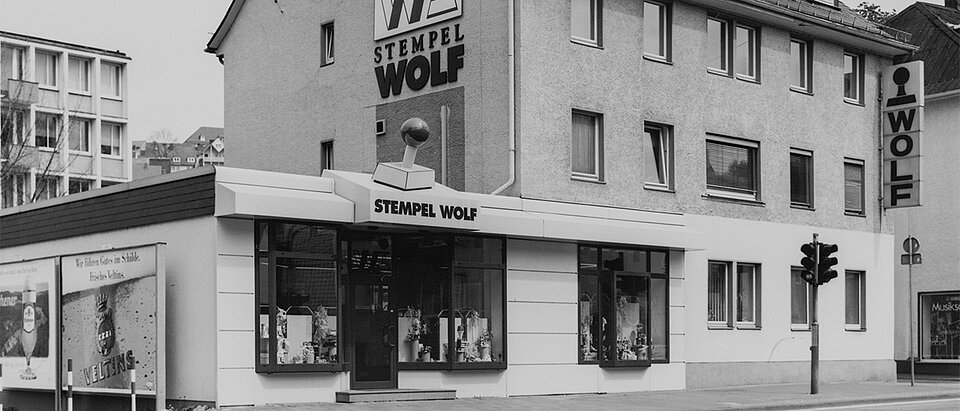Wer Kunststoff bedrucken möchte, stößt schnell auf Hürden, die weniger mit der Maschine als mit der Oberfläche zu tun haben. Kunststoff ist chemisch vielfältig, ändert seinen Zustand im Prozess und trägt oft „unsichtbare“ Zusatzstoffe mit sich herum. Hier sind die Hauptgründe, warum Kunststoff bedrucken anspruchsvoll ist – mit praxisnahen Beispielen.
1) Niedrige Oberflächenenergie: Tinte findet keinen Halt
Viele Polymere (besonders PP, PE) haben eine geringe Oberflächenenergie. Flüssigkeiten ziehen sich zu Tropfen zusammen, statt sich gleichmäßig zu verteilen. Ergebnis: ausgefranste Kanten, „Tropfenbildung“, Wischer.
Praxisbeispiel:
Bei PP-Verschlusskappen wirkt die frisch entformte Oberfläche „wachsartig“. Selbst schnell trocknende Tinten perlen anfangs ab. Erst durch Oberflächenaktivierung (z. B. Corona/Plasma/Flamme) oder durch Tinten mit hoher Anfangshaftung stabilisiert sich das Schriftbild.
2) Additive & Migration: die unsichtbare Trennschicht
Kunststoffe enthalten Trenn- und Gleitmittel, Silikone, Weichmacher, UV-Stabilisatoren. Teile davon wandern mit der Zeit zur Oberfläche (Blooming) – manchmal erst Stunden nach der Herstellung. Wer Kunststoff bedrucken will, sieht dann plötzlich schlechtere Haftung ohne offensichtliche Prozessänderung.
Praxisbeispiel:
ABS-Gehäuse: Am Vormittag hält der Druck, am Nachmittag lässt er sich leichter abreiben. Ursache ist nicht „schlechter Druck“, sondern Additivwanderung. Gegenmaßnahmen sind definiertes Druck-Timing, Reinigung (IPA-Wisch, ionisierte Luft) und eine Tintenzusammensetzung, das solche Effekte toleriert.
3) Feuchte, Staub, Kondensat: kleine Filme, großer Effekt
Mikrofeuchte oder Staub wirken wie Trennmittel. Kondensat entsteht, wenn kalte Teile in warme, feuchte Luft kommen – ein Klassiker, der Kunststoff bedrucken unzuverlässig macht.
Praxisbeispiel:
PET-Behälter in der Abfüllung: feine Feuchtigkeitsperlen lassen Buchstaben „verlaufen“. Abhilfe schaffen Entfeuchtung/gezielte Luftführung, Vorreinigung und die passende Tinte – real in der Linie getestet.
4) Temperatur & Schrumpfung: die Oberfläche „arbeitet“
Beim Abkühlen schrumpfen Spritzteile; im Siegelbereich von Folien entspannt sich der Verbund. Das verändert Mikrorauheit und Benetzung.
Praxisbeispiel:
Verbundfolie (PET/PE) direkt am Siegelrand: leichte Prägung + lokale Wärme führen zu weicher wirkenden Modulen im 2D-Code, während wenige Millimeter daneben alles perfekt ist. Lösung: Tintenwahl an echten Temperaturprofilen prüfen; optional die Druckzone auf ruhigere Bereiche verlegen.
5) Nachgelagerte Belastungen: Mechanik und Chemie nach dem Druck
Die Markierung muss Reibung, Wasch-/Reinigungsmedien, Öle/Fette und Temperaturwechsel aushalten. Manche Tinten sehen direkt nach dem Druck gut aus, verlieren aber später Kontrast oder Adhäsion.
Praxisbeispiel:
Ein Elektronikgehäuse durchläuft eine Reinigungsstation: Der Code wird dort partiell abgetragen. Die Lösung ist nicht „mehr Tinte“, sondern passende Tintenchemie (z. B. pigmentiert/UV) und ein Beständigkeitstest mit den tatsächlichen Medien.
6) Elektrostatik: winzige Kräfte, sichtbare Effekte
Folien und Spritzteile laden sich leicht elektrostatisch auf. Das beeinflusst Tropfenflug, zieht Staub an und verschlechtert die Haftung.
Praxisbeispiel:
Im Winter sinkt die Lesbarkeit von Foliencodes: trockene Luft → höhere Aufladung → mehr Staub. Ionisation, Erdung und eine moderatere Luftfeuchte stabilisieren den Prozess.
7) Regulatorik/Migration: wenn „hält“ nicht reicht
Bei Primärverpackungen (Food/Pharma) muss eine Markierung beständig sein und strenge Migrationsgrenzen einhalten. Das macht Kunststoff bedrucken zusätzlich komplex: Low-Migration-Tinten, validierte Prozesse, Dokumentation.
Praxisbeispiel:
Becherkennzeichnung besteht optisch – fällt aber in der Migrationsprüfung durch. Hier zählen geeignete Formulierungen und eine validierte Aushärtung.
Weitere Praxisfälle zum Thema Kunststoff bedrucken finden sich in unserer Beispielübersicht Kunststoff.
Kurzfazit: Was es „schwer“ macht – und was hilft
Schwer wird Kunststoff bedrucken durch:
- niedrige Oberflächenenergie,
- Additivwanderung und Kontamination (Feuchte/Staub),
- Temperatur- und Materialstreuung,
- nachgelagerte Belastungen (Mechanik/Chemie),
Hilft in der Praxis:
- Tintenfenster mit 2–3 Formulierungen (z. B. MEK, alkoholisch, UV),
- gezielte Oberflächenaktivierung,
- einfache, relevante Tests am Originalteil (Wisch, Beständigkeit, Grading),
- eine schlanke Verifikation im Lauf (Trends statt Überraschungen).
So wird aus „schwer“ ein beherrschbarer Prozess – und Kunststoff bedrucken funktioniert zuverlässig.